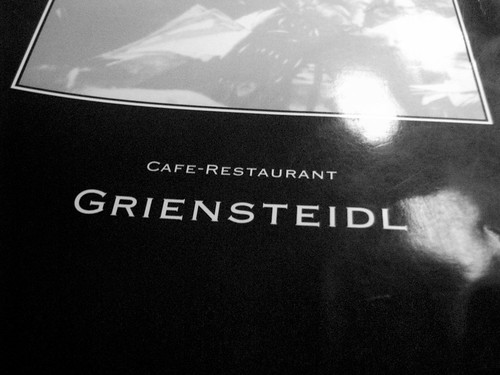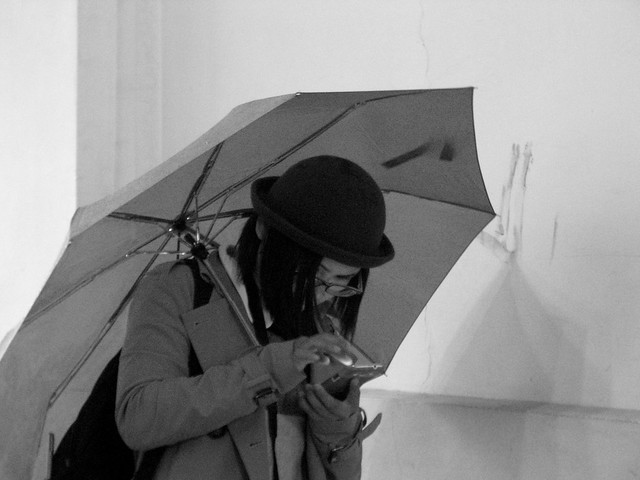26. Dezember 2014



Sacher. Demel. Hawelka. Prater. Riesenrad. Fiaker. Grinzing. Heuriger. Hofburg. Burgtheater. Kaffeehaus. Walzer. Sachertorte. Qualtinger. Einspänner. Schlagobers. Heller. Sezession. Jugendstil. Schönbrunn. Klimt. Schiele. Opernball. Sissi. Conchita. Würschtel. Mehlspeisen. Stephansdom. Naschmarkt. Wien. Finden Sie den Fehler. Ich sage mal so: ein Fehler in dem Sinn, dass sich in der Aufzählung der bekanntesten Wien-Schlager, einer eingemogelt hätte, der nicht hineingehört, ist nicht festzustellen. Die Wienkenner werden die Augen verdrehen, dass hochkarätige Kultur-Erscheinungen wie Alfred Loos und Karl Kraus und die ungefähr siebzig anderen Kaffeehäuser nicht dabei sind. So wie Vieles noch erarbeitet und ergänzt werden müsste. Aber was da oben aufgezählt ist, sind die Dinge und Phänomene, von denen ich unterstelle, dass jeder schon einmal davon gehört hat, der weiß, dass die Stadt Wien überhaupt existiert, ohne sie je betreten zu haben. Und wenn wir uns nun die drei genannten gastronomischen Institutionen Sacher, Demel, Hawelka anschauen, ist es doch schon betrachtenswert, warum ein Kaffeehaus mit so einem komplizierten Namen wie Hawelka da drin ist. Womit hat es das Hawelka geschafft, als eine derartige Sehenswürdigkeit zu gelten, dass man das Gefühl hat, man kann keinesfalls abreisen, ohne wenigstens selbst einmal geschaut zu haben, was es damit auf sich hat? Es ist halt einfach... alles. Die Geschichte. Das Mobiliar. Die ganze Legende. Die Bilder. Die Schummerbeleuchtung. Die Litanei der berühmten Gäste. Die Lage. Dorotheergasse. Erster Bezirk. Alles kommt zusammen. Und das Etablissement ist noch immer in Familienbesitz, seit achtundsiebzig Jahren. Seit die Gründer, der Leopold und die Josefine nicht mehr sind, haben die Kinder und Kindeskinder das Geschäft in die Hand genommen und schnell begriffen, was ja auch nicht schwer ist, dass sie rein gar nichts verändern dürfen. Und bloß nicht renovieren! Das ist die halbe Miete vom Hawelka. Ausgefranste Kanapees. Dunkelgerauchte Wände. Verblichene Kritzeleien. "Vor 30 Jahren waren diese Wänd' einmal weiß" , sagt Günter Hawelka, 69, erklärend. Die seither eingetretene Verdunkelung sieht er als edle Patina an. "Rauchen gehört zum Kaffeehaus mit dazu, denn im Kaffeehaus ist immer geraucht worden. Ein Rauchverbot ist ein Frevel an der Kaffeehauskultur", ist der Sohn des Hawelka-Namensgebers Leopold Hawelka überzeugt. Das stammt aus einem Artikel im Standard über das Für und Wider der Rauchkultur im Wiener Kaffeehaus. Im Wikipedia lesen wir: Heimito von Doderer schrieb bereits 1960 über das Hawelka: „Es ist bereits in London bekannt, und es treffen auch Leute aus Paris und den Niederlanden im Café Hawelka ein“ – und warum: „Letzten Endes nur deshalb, weil Herr Hawelka nicht renoviert.“ In der Tat ist das Interieur der Räumlichkeiten, das von einem Schüler des Architekten Adolf Loos entworfen worden sein soll, seit 1912 unverändert geblieben. Also auf ins Hawelka. Im Sacher war ich zum Beispiel nicht. Und im Demel auch nicht, aber fast. Das Demel ist ja mehr so ein hochklassiger Tortentempel. Aber im Hawelka kann man sich auch nur zum Saufen und hoffentlich bald auch wieder Rauchen aufhalten. Man muss nicht die ewigen Buchteln essen, man kann auch gleich zu den harten Drogen übergehen!


Über die ganzen Künstler und Prominenten kann man ja überall lesen. Auf der Seite vom Hawelka selber gefällt mir die Formulierung ganz gut: "Während der Sechziger und Siebziger stellt das Café Hawelka schließlich alles dar, was in der Wiener Künstlerszene frisch und tatendrängig ist. Eine Tatsache, die auch immer mehr Berühmtheiten aus dem Ausland anzieht." Tatendrängig! Auch ich fühle mich direkt tatendrängig, wenn ich das lese! Der Standard hat es ganz gut beschrieben. Und so eine tumblr-Sammelsurium-Seite gibt es auch. Wer jemals die Heller-Biographie Feuerkopf liest, muss sich durch mehrere Kapitel arbeiten, die sich ausschließlich im Hawelka abspielen. Für Heller war das Lokal seine Privatuniversität, in der er sich bereits im zarten Alter von vierzehn Jahren von Tisch zu Tisch gearbeitet hat, bis er selber ein Teil des Inventars war und auf Augenhöhe mit Qualtinger schwadronieren konnte. Da ist ein anschauliches Amateur-Video, mit einem Schwenk durchs Lokal am Tag. Und da erzählt ab Minute 1:45 der Sohn Günter Hawelka von der Geschichte. Und hier ist noch ein siebenminütiges, etwas gewöhnungsbedürftiges Filmdokument, in dem die Tochter Herta mit ihrem Vater und einer Reporterin auf der Polsterbank zu sehen ist, da wo wir auch gesessen sind. Das etwas merkwürdige an dem Interview ist, dass die Reporterin eigentlich dem alten Hawelka (da war er schon 99, also ein Jahr vor seinem Tod) die Fragen stellt, aber die Tochter antwortet, weil er wahrscheinlich schlecht hört und nicht mehr so ganz beieinander ist. Er sitzt fast ein bißchen wie entmündigt da und rührt in seinem Kaffee und kriegt scheinbar nur die Hälfte mit, wenn überhaupt. Aber immer adrett mit einem Mascherl, wie der Wiener sagt. Die Tochter beantwortet jedenfalls alles komplett. Wahrscheinlich hätte man ihn auch kaum verstanden, wenn er es selber gemacht hätte. Aber immerhin behauptet die Herta, dass er manchmal noch Anweisungen geben würde. Na ja. Wir werden alle einmal alt, so Gott will, jedenfalls. Nur wer jung stirbt, muss sich nicht mit Alterserscheinungen herumplagen. Die drei kleinen Filme geben insgesamt schon einen guten Eindruck. Aber wie schön schummrig es im Dunkeln ist, sieht man auf meinen Bildern. Wir sind vom Griensteidl kreuz und quer durch den Nieselregen hingelaufen, es war schon fast dunkel. Schon am Eingang habe ich mich gleich recht wohl gefühlt, weil ich eine starke Vorliebe für Lokale mit wenig Beleuchtung habe. Da kommt doch eine ganz andere Stimmung auf! Es war von der Uhrzeit her irgendwas zwischen sieben und acht, denke ich. Das Hawelka hat zum Beispiel bis 2 Uhr nachts auf, daran sieht man schon, dass es sich nicht um so ein betuliches Tanten-Café handelt, wo sich alles nur um Zuckerbäckerwerk dreht. Wir haben uns zuerst im hinteren Bereich auf so eine schöne gestreifte, samtgepolsterte Bank gesetzt, da hat man aber nicht so gut gesehen. Gerade wo wir bestellt haben, ist die schönste Polsterbank frei geworden, die vor der Mittelwand steht und von der aus man in den vorderen Gastraum und zur Tür schauen kann.




Ich habe diesmal doch einen Kaffee Maria Theresia bestellt, weil er anders als im Griensteidl ohne die komischen Zuckerstreusel gemacht wird. Knirschende Zuckerstreusel brauche ich nicht auf dem Kaffee! Außerdem meine ich, dass der Alkohol eine Mischung aus Orangenlikör und Weinbrand war. Es gibt da ein paar kleine Varianten in der Zubereitung. Hier ist ein sehr schönes Rezept: "Maria Theresia hat es dagegen gerne hochprozentig, mit einem (sehr oft großzügigen) Schuss von (zu gleichen Teilen) Orangenlikör und Weinbrand, im verlängerten Mocca, mit Orangenzesten, Zucker und Schlagobersgupf, ebenfalls im Laufglas serviert." Und da ist noch eins mit schönem Foto. Jedenfalls hat mir der Maria-Theresia-Kaffee vom Hawelka ganz ausgezeichnet geschmeckt. Auch liebe ich recht viel Schlagobers oben drauf. Wenn ich das Bild mit unserem Tisch so betrachte, scheint es mir, als hätte Duke sogar Kaffee getrunken. Wahrscheinlich einen Verlängerten. Auf keinen Fall mit Schlag. Da wird ihm schlecht! Es ist nicht bei einem Maria-Theresia-Kaffee bei mir geblieben, weil es doch sehr gemütlich war, da zu sitzen und hinaus in den Regen zu schauen, wie er so an die Scheiben und auf das Kopfsteinpflaster der nächtlichen Dorotheergasse prasselt. Ich war wirklich froh, dass das letzte Lokal so ein schönes war, wo man nicht insgeheim gedacht hat, viel Tamtam um Nichts! Es ist halt furchtbar bequem da. Und der Ober lässt einen in Ruhe. Wer etwas anderes wahrgenommen hat, muss vielleicht noch einmal nach Einbruch der Dunkelheit hin, an einem schönen Regentag.



Wie der Abend zu Ende gegangen ist, möchte ich mit Hilfe eines Auszuges aus einer Antwortmail an Victor beschreiben, in der ich vor ungefähr drei Wochen unter anderem auf seine Frage antwortete, was ich mir bei meinem nächsten Wienbesuch anschauen wollen würde: "(...) und die Burg würde ich mir auch anschauen, in eine Aufführung gehen und ins Café Landtmann darunter. Ich habe ja auch nicht einmal das Hotel Sacher richtig vor mir gehabt, weil keine Zeit war, war ich in der Ecke gar nicht und das gehört doch dazu und dann habe ich den Taxifahrer am letzten Abend, nachdem wir im Hawelka waren, und es schon dunkel war und in Strömen geregnet hat, gebeten, doch bitte wenigstens mit dem Taxi einmal da vorbeizufahren, am Sacher und an der Burg und da hat er dann eine richtige kleine Stadtrundfahrt draus gemacht, mit viel extra Erklärungen auch zum Parlament - aber da hat er dann angefangen zu politisieren und da wurde es ein bißchen haarig. Er hat allen Ernstes Adolf Hitler erwähnt. Also irgendwie entschuldigend. Da habe ich ziemlich geschluckt. Duke hat dann auch, nachdem bis dahin alles sehr freundlich und nett war im Taxi, einen energischen Einwand gebracht, frag mich nicht mehr, was genau. Ich war nur saufroh, dass wir bald in der Lambrechtgasse waren. Die Stimmung war dann etwas abgekühlt, weil der alte Wiener gemerkt hat, dass wir nicht in dieselbe Richtung wie er denken. Huiuiui. Das war ein Schauspiel für sich..." Ja. So war das. Ich habe also das Sacher durch die Scheibe im nächtlichen Regen gesehen. Und das Burgtheater. Und das Parlament. Wo die Kasperln drin sind, das Kasperltheater, wie der Taxifahrer gemeint hat. Wo er noch lustig war. Es kann ja auch nicht alles immer komplett perfekt sein. Aber es war schon nah dran. Wir sind nicht so spät in der Lambrechtgasse angekommen, denn wir wollten noch essen, es war ja noch einiges im Eiskasten, wie der Wiener sagt. Und richtiger Champagner sogar und Rotwein, der musste ja auch weg. Ich hätte im Flieger ja auch gar keine Flasche mitnehmen dürfen. Packen mussten wir auch noch. Was man alles muss, wenn man Wien verlassen muss. Ich habe noch ein paar Bilder für morgen und übermorgen und sogar überübermorgen in petto. Es wird noch ausführlich abgereist. Da bin ich sehr genau. Das war nicht der letzte Streich. Und wenn dieses ereignisreiche Jahr nun zu Ende geht, werde ich in meinem Flieger sitzen, heim von Wien nach Berlin und Duke in seinem Zug.
: : alle Wiener Geschichten : :
g a g a - 26. Dezember 2014, 23:38